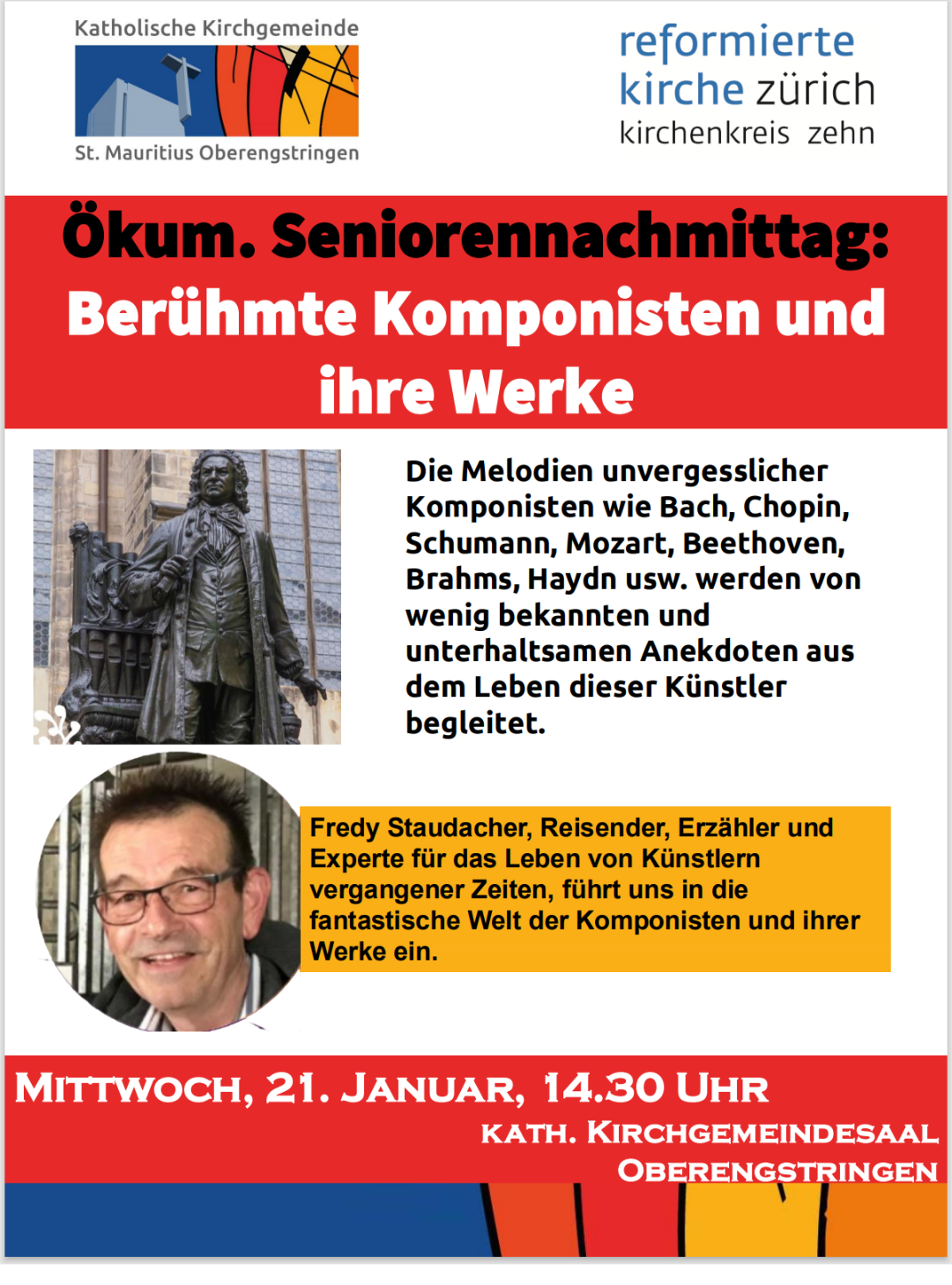
Zum Abschluss begleiten Kaffee und Kuchen gesellige Gespräche.
Ort: Saal der kath. Kirchgemeindehaus Oberengstringen, Dorfstrasse 59, 8102 Oberengstringen.

Katholische Kirchgemeinde St. Mauritius Oberengstringen
Willkommen und Grüss Gott auf unserer Homepage
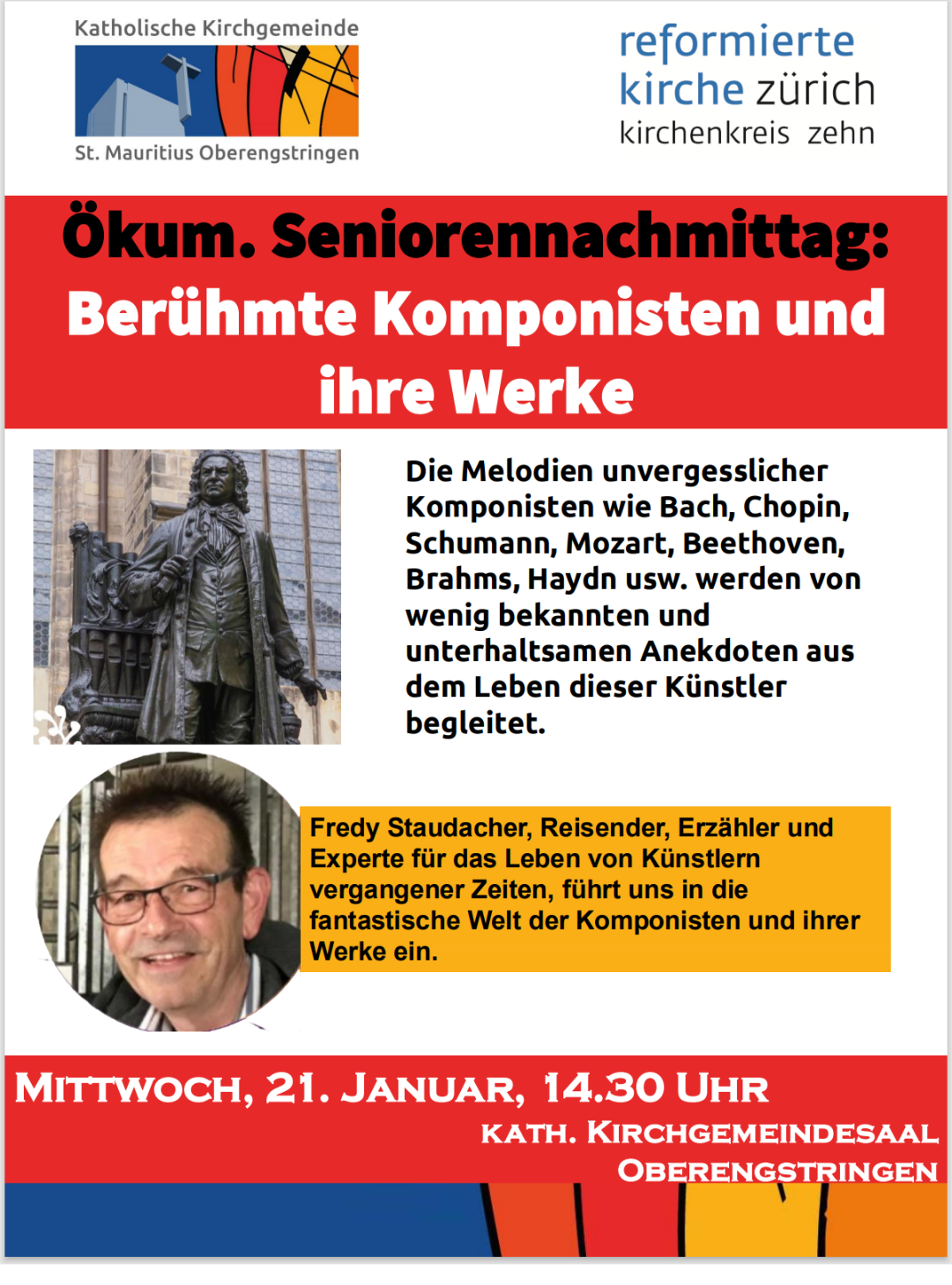
Zum Abschluss begleiten Kaffee und Kuchen gesellige Gespräche.
Ort: Saal der kath. Kirchgemeindehaus Oberengstringen, Dorfstrasse 59, 8102 Oberengstringen.
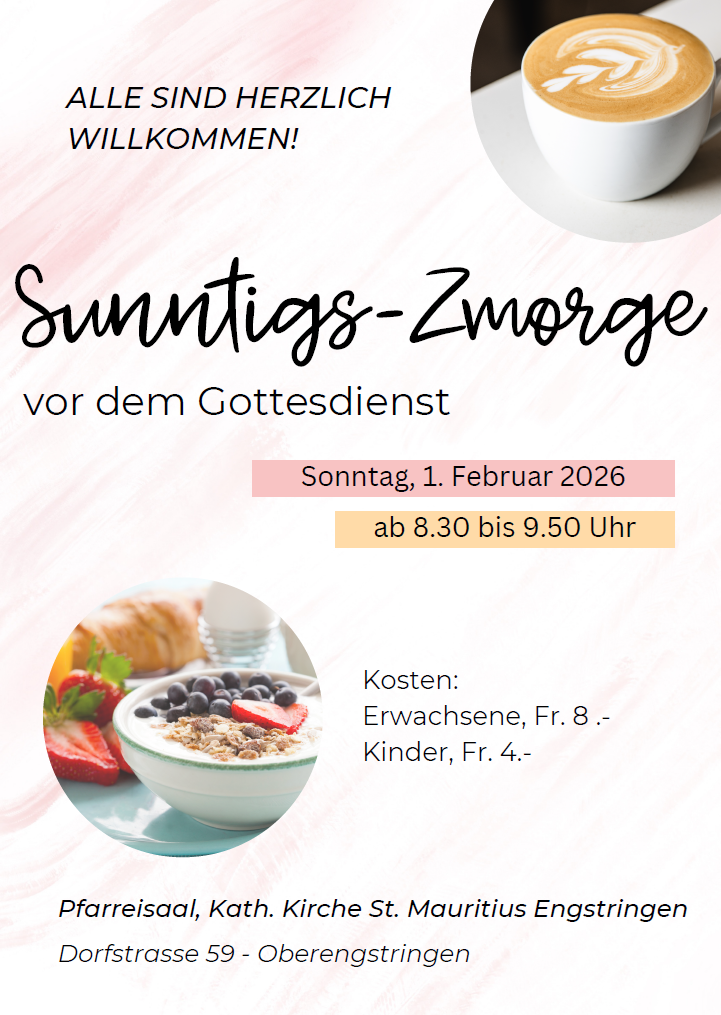

Es ist unterdessen eine gute Tradition geworden, dass wir jeweils im Januar mit der katholischen Kirchgemeinde Engstringen und den Benediktinerinnen des Klosters Fahr einen ökumenischen Gottesdienst in der Klosterkirche feiern.
Wir orientieren uns thematisch an den Textvorschlägen der Gebetswoche für die Einheit der Christen, welche diesem Sonntag vorangeht.
Zusammengestellt wurden die Unterlagen für 2026 von Vertretern verschiedener Kirchen aus Armenien. Dieses Land war das erste, welches das Christentum zu seiner offiziellen Religion erklärte, und zwar bereits im Jahr 301 n. Chr. Man spürt einzelnen liturgischen Elementen, die wir für unseren Gottesdienst übernehmen, etwas von ihrer altehrwürdigen Herkunft und langjährigen Bewährung ab. Sie drehen sich im Wesentlichen um das Licht, das mit Jesus Christus in die Welt gekommen ist.
Priorin Irene Gassmann, Seelsorgerin Petra Hug und Pfarrer
Christoph Frei, freuen sich, gemeinsam und mit reger Beteiligung aus
unseren Gemeinden zu feiern.
Kinderprogramm während des Gottesdienstes, mit Beginn für alle
in der Kirche.
Anschliessend Apéro

Freitag, 6. März 2026, 18.30 Uhr, Katholische Kirche Oberengstringen
Der schweizerische Weltgebetstag ist Teil einer weltweiten
Bewegung von Frauen aus verschiedenen christlichen
Traditionen. Jedes Jahr, am ersten Freitag im März, laden sie
alle zum Feiern eines gemeinsamen Gottesdienstes ein.
Die diesjährige Liturgie haben Frauen aus Nigeria vorbereitet.
Anschliessend laden wir Sie herzlichst zu einem kleinen
Imbiss ein.
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Informationen der Pfarrei St. Mauritius Engstringen.
Lageplan Kath. Kirche und Friedhof
Die Kirche ist in der Regel täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr und die Kapelle von 7.30 bis 19.30 Uhr geöffnet.
Gottesdienste und weitere Anlässe finden Sie hier: Agenda

 Jetzt anmelden für das neue Schuljahr 2025/26:
Jetzt anmelden für das neue Schuljahr 2025/26:
Katholischer Religionsunterricht in Ober- und Unterengstringen!
Unser Katecheten-Team begleitet Ihr Kind ab der 1. Klasse auf dem Glaubensweg und stärkt seine ganz individuelle Beziehung zu Gott. Auch ältere Kinder, die bisher noch nicht teilgenommen haben, sind herzlich willkommen – ein Einstieg ist nach Vereinbarung jederzeit möglich!
Gemeinsam mit den Kindern leben wir unser Pfarrei Motto: Hand in Hand mit Jesus in einem Boot. Neben dem «Unti» gibt es auch vielfältige Mitmach-Angebote: Singen im Kinderchor «Les Rossignols», mitwirken im Gottesdienst als Ministrant*in oder eine Rolle im Krippenspiel übernehmen – um nur einige davon zu nennen.
Die Datenpläne 2025/26 sind bereits freigeschaltet – bitte beachten Sie dazu die Rubrik «Katechese + Unti».
Anmeldung & Infos:
Melden Sie Ihr Kind mit dem Anmeldeformular auf dieser Homepage an (Katechese + Unti) oder kontaktieren Sie direkt: Tobias Wicki, Leitung Katechese
079 952 09 98 / tobias.wicki@kath-kirche-engstringen.ch